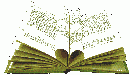|
|
|
Nicht nur in Bibliotheken fragt man sich das, und selbst in diesen „heiligen Tempeln des Buches“
ist man sich der Antwort wohl nicht mehr so sicher – denn: immer mehr Bibliotheken bieten ihren Klienten
zusätzlich zum herkömmlichen Buch und Zeitschriftenaufsatz auch deren elektronischen Varianten an.
Diese Frage wieder aufzugreifen, motivierte mich die Lektüre der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift „Gehirn und Geist“,
die sich dem Hauptthema „Wie das Internet unser Denken erobert“ widmete und dabei auch eine längere Untersuchung
über „Die Vorzüge des Blätterns“ abdruckte.
Immer mehr Texte lesen wir heutzutage am Bildschirm, und es ist auch wirklich sehr bequem,
wenn ich so ganz nebenbei meine Hochschulbibliothek beauftragen kann, einen interessanten Aufsatz
zu Plansprachen mal kurz per Fernleihe zu besorgen, und dieser Text dann idealerweise „ohne Papier“ geliefert wird,
so dass ich ihn gleich am nächsten Tag lesen und bei Bedarf auch drucken kann. |
|
Ich gestehe auch gerne ein, dass ich das größte und schwerste Buch, das je in Esperantujo erschien,
nicht mehr missen möchte und es fast täglich konsultiere, indem ich dessen elektronische Ausgabe
auf meinem lokalen Rechner befrage: eine Suche in den über 14 Tausend
Periodika in und zu Esperanto, die unser Freund Árpád Máthé zusammengetragen hat
(wir haben mehrfach darüber berichtet, auch Detlev Blanke diesjährigen Heft 2),
geht eben viel zügiger von der Hand, weil die entsprechende Datei immer und überall für mich verfügbar ist.
Aber das ist nicht gemeint, wenn man die oben formulierte Frage aufwirft.
Besser sollte man vielleicht so fragen: „Kann in Sachen Lesbarkeit die digitale Lektüre
mithalten mit dem guten alten Schmöker?“
Der New-Yorker Wissenschaftsjournalist Ferris Jabr überschrieb seinen
Artikel „Die Vorzüge des Blätterns“; und das verrät uns schon, wie das Duell
wohl ausgehen dürfte.
 |
|
In Kurzform seine Hauptthesen:
- Ein aufgeschlagenes gedrucktes Buch besitzt eine klare
Seitenaufteilung, so dass wir uns in ihm viel besser und schneller
orientieren können als in einem E-Book; denn unser Gehirn interpretiert
Texte ähnlich wie Landschaften.
- Wer Texte auf Papier liest, merkt sich mehr Informationen als bei
digitaler Lektüre.
- Leuchtende Bildschirme und das ständige Scrollen strapazieren die
Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis zusätzlich.
Ein geöffnetes Buch bietet einfach viel mehr: mit seiner rechten und
linken Kante bietet es auf jeder Seite noch vier Ecken, so dass sich diese
Topographie als Landkarte für unser Hirn geradezu ideal anbietet. Mit den
Händen spüren wir bereits aufgrund des Gewichts der bereits gelesenen
Seiten, wie weit wir im Stoff schon sind. Die Haptik eines Buches offeriert
uns Möglichkeiten zum Navigieren mit vielen Sinnen, es beansprucht also
weniger kognitive Kapazitäten; so bleibt uns mehr an Aufmerksamkeit, um den
Inhalt zu erschließen. Das ist durch Tests untermauert.
|
|
Wie kommt es wohl, dass Studenten ihren in digitaler Form gelesenen
Lehrstoff zwar gut erinnern können, aber nicht einfach
wissen?
Psychologen kennen zwei Arten, wie etwas im Gedächtnis behalten wird:
- Informationen in Verbindung mit ihrem Kontext (was habe ich wo und
wann und wie erfahren?) rufen wir beim Erinnern ab.
- Wenn wir etwas wissen, dann sind wir der Ansicht, dass diese
Information wahr ist, ohne dass wir genau angeben könnten, wo wir ihr das
erste Mal begegnet sind (mein Geburtsdatum, wie alt bin ich?).
Als weiterer Effekt kommt dazu, dass digitales Lesen schneller ermüdet und mehr stresst.
Interessant ist auch, was eine Mitarbeiterin von Microsoft Research Cambridge herausfand:
Leser von E-Books haben weniger das Gefühl, das Buch im Gerät auch wirklich zu besitzen.
Eine ähnliche Skepsis brachte man in den Anfängen der digitalen Musik entgegen;
und doch ist es heute für die meisten völlig normal, ihre Musiktitel aus dem Netz herunterzuladen,
sie zu verwalten oder gar zu tauschen. Mag sein, dass dem digitalen Lesestoff ein solcher Wandel
auch noch bevorsteht.
|
|
Statt Konkurrenz wünsche ich mir mehr Koexistenz, und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dorthin.
Doch stellt sich mir heute schon die Frage: „Wie haltbar sind denn wohl die Lesegeräte für die elektronischen Bücher?“–
Das muss sich wohl in einem Vergleich erweisen:
In den Lesesälen unserer Universitätsbibliotheken stehen Grundlagenwerke, die schon 30 oder mehr Jahre auf dem Buckel haben
und bereits von tausenden Menschen gelesen wurden. Und ihre Informationen sind immer noch lesbar und von Wert.
Sehr oft hat man sogar mehrere dieser Werke vor sich liegen, um zu vergleichen,
und zuweilen ist der Schreibtisch schon zu klein dazu.
Wie aber wird ein Lesegerät für elektronische Bücher nach 20 Jahren noch aussehen?
Wird es wohl mehr als ein paar Dutzend Benutzer überlebt haben? Eigene Erfahrungen damit habe ich nicht,
weil ich selber noch kein solches Gerät zuhause habe, wie vielleicht mancher unserer Leser.
|
|
Doch der Trend dazu ist bereits eingeläutet, seit die öffentliche Bibliothek von San Antonio in Texas
ihren Plan publizierte, im Herbst 2013 ihre
 zu starten (den landesweit ersten Prototyp einer buchlosen Bibliothek),
nicht als Ersatz für das städtische Bibliothekssystem, sondern als Erweiterung
der erst 2005 fertig gestellten Public Library, welche fast 600 000 Bände umfasst
und mit 27 Zweigstellen arbeitet.
zu starten (den landesweit ersten Prototyp einer buchlosen Bibliothek),
nicht als Ersatz für das städtische Bibliothekssystem, sondern als Erweiterung
der erst 2005 fertig gestellten Public Library, welche fast 600 000 Bände umfasst
und mit 27 Zweigstellen arbeitet.
Geplant war, für rund 250.000 $ einen Grundstock von 10.000 elektronischen Büchern zu beschaffen.
Inzwischen redet man von Kosten in Höhe von 2,3 Millionen $. Vor allem bildungsfernen Schichten
will man damit einen einfachen Zugang zu Literatur ermöglichen;
denn San Antonio ist zwar die zweitgrößte Stadt in Texas und die siebtgrößte in den USA,
rangiert aber bei der Alfabetisierung erst an Stelle 60.
 |
|
|
Diese erste bücherlose Bibliothek startete im vorigen Herbst mit 10.000
Titeln und 100 ausleihbaren Lesegeräten sowie 50 mit vorinstallierten Titeln
für Kinder. Vor Ort will man 50 stationäre Rechner vorhalten, nebst 25
Klapp- und 25 Tabletrechnern. Wer allerdings nicht auf Papier verzichten
möchte, hat die Möglichkeit kostenpflichtig auszudrucken. Heute bietet die
BiblioTech mehr als 20.000 eBooks, über 7.000 Comics, 70 populäre
Zeitschriften, über 100.000 audioBooks, über 100.000 Film- und Musiktitel,
16 Englischkurse und 61 Fremdsprachenkurse. |
|
Dennoch bleiben viele Fragen offen: Urheberrecht, Verfügbarkeit, Speichermedien, Kosten, Handling,
Bibliotheksangebote außer Medien-Ausleihe
…
Man wird ja sehen, wie sich dieses Pilotprojekt entwickelt und ob es
auch für wissenschaftliche Bibliotheken taugt.
vielleicht wird es letztlich doch heißen:
„die gesunde Mischung macht’s?“
und nicht: „Bücher? Wer braucht schon gedruckte Bücher? Bibliotheken vielleicht?
Nein, nicht mal die brauchen Bücher,
wie uns die öffentliche Bibliothek von San Antonio in Texas vorführt.“
|